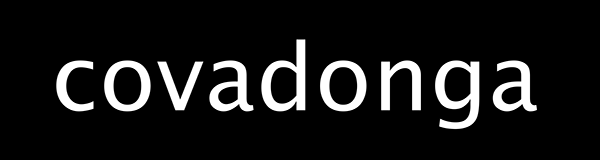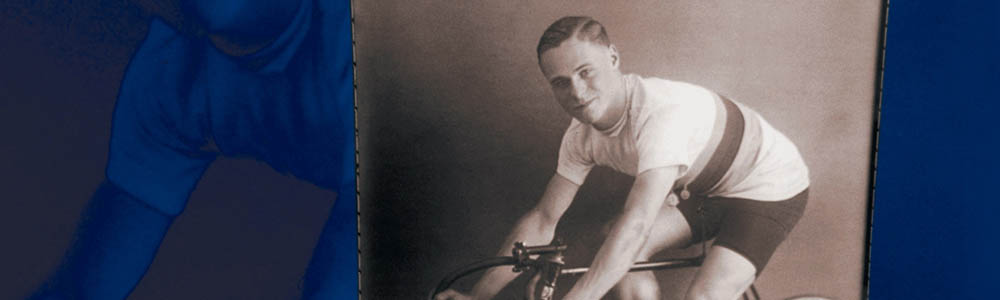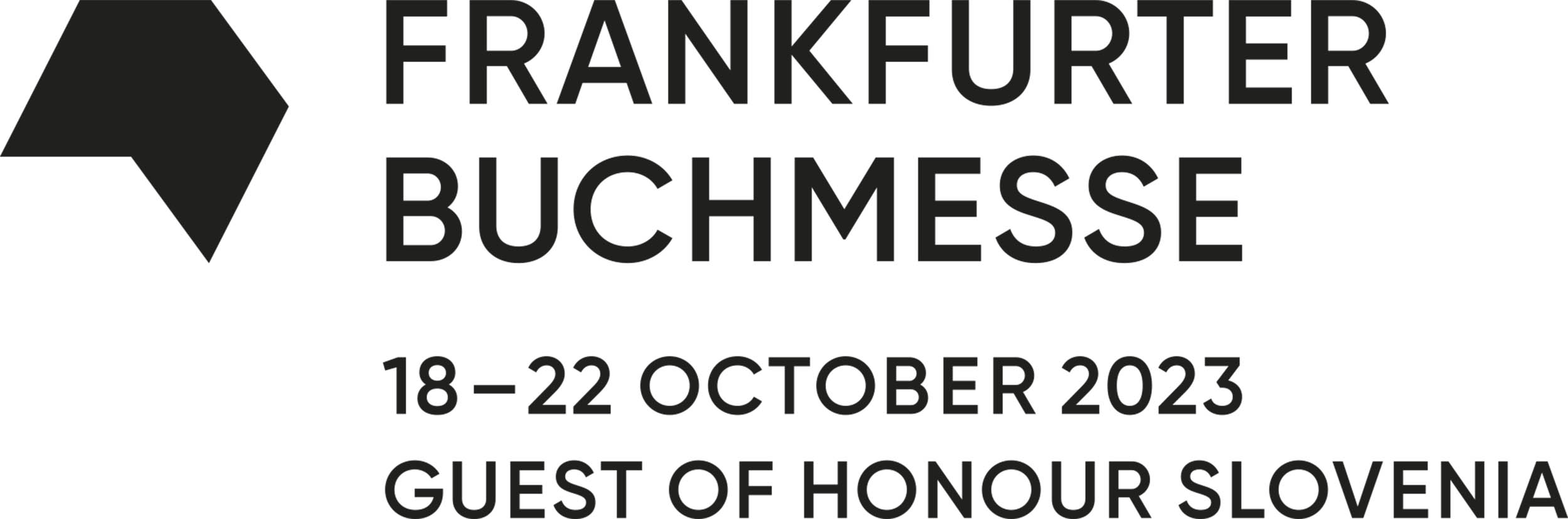Teamtoto geht wieder los
Es ist wieder so weit: Das kostenlose Radsport-Managerspiel des Covadonga Verlags startet jetzt in eine neue, seine mittlerweile bereits 22. Saison. Los geht es wie immer mit einem knapp fünfwöchigen Teamtoto zu den Frühjahrsklassikern. Wir würden uns sehr freuen, euch als Mitspieler begrüßen zu dürfen. Hier geht’s zur Anmeldung: www.teamtoto.de […] Weiterlesen